
Milchiges oder grau- weißes Teichwasser sieht nicht nur unschön aus, es kann dem Teich auch schaden. Auslöser können verschiedene Algen, Kalkablagerungen oder eine ungenügende Filterleistung sein. Wir geben einen Überblick über die möglichen Auslöser und hilfreiche Maßnahmen zur Abhilfe.
Hinweis: Völlig frei von Bakterien und Algen wird man den Teich nie bekommen. Das ist auch gar nicht wünschenswert, denn auch diese Organismen erfüllen, wenn sie nicht überhandnehmen, eine wichtige Funktion im Stoffkreislauf.
1: Bakterienblüte

Immer wieder sorgen Bakterienblüten für ein milchiges Teichwasser. Auslöser für eine Bakterienblüte können tote Tiere und Pflanzenreste im Teichsediment sein, die sich langsam zersetzen. Mit der Zeit gelangen die organischen Zersetzungsprodukte durch Rücklösung aus dem Sediment ins Wasser.
Die sogenannten saprobionten Bakterien nutzen dabei Schwefelwasserstoff oder Methan als Energielieferant. Während der Zersetzung werden Faulgase und Stoffwechselabbauprodukte wie Ammonium, Nitrit, Nitrat und Phosphate freigesetzt, welche man in extremeren Fällen auch an aufsteigenden Blasen erkennen kann.
Erkennung einer Bakterienblüte
Das Teichwasser verfärbt sich innerhalb weniger Tage milchig und trüb. Die Sicht ist stark eingeschränkt, jedoch sind keine Schwebeteilchen im Wasser zu erkennen. Eine Filterung des Teichwassers schafft keine Abhilfe.
Ursachen
Zur Bakterienblüte kommt es, wenn das Wasser übermäßig mit Nährstoffen belastet ist. Dies kann durch zu viele organische Abfälle oder auch durch eine Überfütterung der Fische zustande kommen.
Abhilfe
Es ist sinnvoll, so schnell wie möglich den Teichboden abzusaugen und das abgelagerte Sediment, den Mulm und Detritus mit Hilfe einer starken Teichpumpe zu entfernen.
Im Wasser treibende Schwebstoffe, Bakterienflocken und anderes „Treibgut“ sollte man zuerst mit einem feinmaschigen Kescher abfischen und anschließend mit Hilfe eines leistungsfähigen und feinfiltrigen (am besten mit Filterwatte) Teichfilters filtern. Zuletzt tauscht man noch ⅓ des des Teichwassers gegen frisches Leitungswasser aus. Je nach schwere der Bakterienblüte kann es erforderlich sein in den nächsten Tagen weitere Teilwasserwechsel von ⅓ des des Teichwassers vorzunehmen.
Achtung: Es sollte nie mehr wie 1/3 des Teichwassers auf einmal gewechselt werden, um die notwendigen Bakterien im Teich zu erhalten!
2: Schlechte Filtration

Wird das Teichwasser nicht ausreichend filtriert, kommt es zur Ansammlung von Partikeln, welche sich im Wasser ablagern. Durch die Partikelsammlung erscheint das Teichwasser milchig und trüb.
Erkennung einer schlechten Filtration
Mit bloßem Auge lassen sich die Partikel im Wasser nur schlecht erkennen. Man könnte diese zwar mit einem speziellen Zählsystem ermitteln, einfacher geht es jedoch, wenn man den Filter selbst checkt. Am einfachsten überprüft man dafür die folgenden Punkte:
- Ist die Ansaugstelle verstopft?
- Findet eine Umwälzung des kompletten Teichwassers statt, sodass auch das komplette Wasser durch den Filter befördert wird?
- Sind die Filtereinheiten im Filter verschmutzt?
- Sind passende Filtereinheiten im Filter verbaut?
- Ist der Teichfilter ausreichend groß ausgelegt?
Ursachen
Der genutzte Teichfilter ist für die Größe des Teiches nicht ausreichend oder verfügt über kein ausreichend feines Filtersystem. Damit eine ausreichende Filterung stattfindet, muss der Filter eine dem Teich angepasste Durchlaufmenge aufbringen:
- Zierteich ohne Fische: Die Durchlaufmenge des Filters muss mindestens 20% der Menge des Teichwasser entsprechen. Sprich, bei einem Teich mit 10.000 Liter sollte der Filter einen Durchfluss von mindestens 2000 l/h haben!
- Teich mit Fischen: Die Durchlaufmenge des Filters sollte mindestens 40% der Menge des Teichwassers entsprechen. Bei einem Teich mit 10.000 Liter sollte der Filter einen Durchfluss von mindestens 4000 l/h haben!
- Teich mit Koi-Fischen: Da Koi-Teiche oftmals dichter besetzt sind und die Kois viel ausscheiden, erfordern ein Koiteich eine noch höhere Pump-Leistung. Hier sollte das gesamte Teichwasser 1x pro Stunde umgewälzt werden. Sprich, bei einem Teich mit 10.000 Liter sollte der Filter einen Durchfluss von mindestens 10.000 l/h haben!
Zudem kann ein unzureichendes Filterelement, ein verdreckter/ lange nicht gereinigter Filter oder auch eine Verstopfung die Partikelsammlung und somit die weißliche Wasserfarbe verursachen.
Abhilfe
- Sicherstellung, dass ein ausreichend dimensionierter Filter eingesetzt wird
- Filterreinigung durchführen und ausschließen, dass eine Verschmutzung oder Verstopfung vorliegt
- Eine regelmäßige Filterreinigung stellt sicher, dass der Filter optimal arbeitet
- Biologisches Filtermaterial hilft bei der Ansiedlung nützlicher Bakterien im Teichwasser und baut Schadstoffe ab
- UV-Filter töten Algen durch UV- Licht ab
- Der Einsatz von Teichpflanzen fördert zusätzlich die Filtration im Teich. Schilf, Seerosen oder Sauergras helfen, überschüssige Nähstoffe zu absorbieren.
3: Kalkausfall
Ein hoher Gehalt an Magnesium und Calcium im Teichwasser kann unter bestimmten Umständen zum Ausfallen der Mineralien aus dem Wasser führen. Die dann nicht mehr gebundenen Mineralien sind die Ursache für ein milchiges Teichwasser.
Erkennung von Kalkausfall
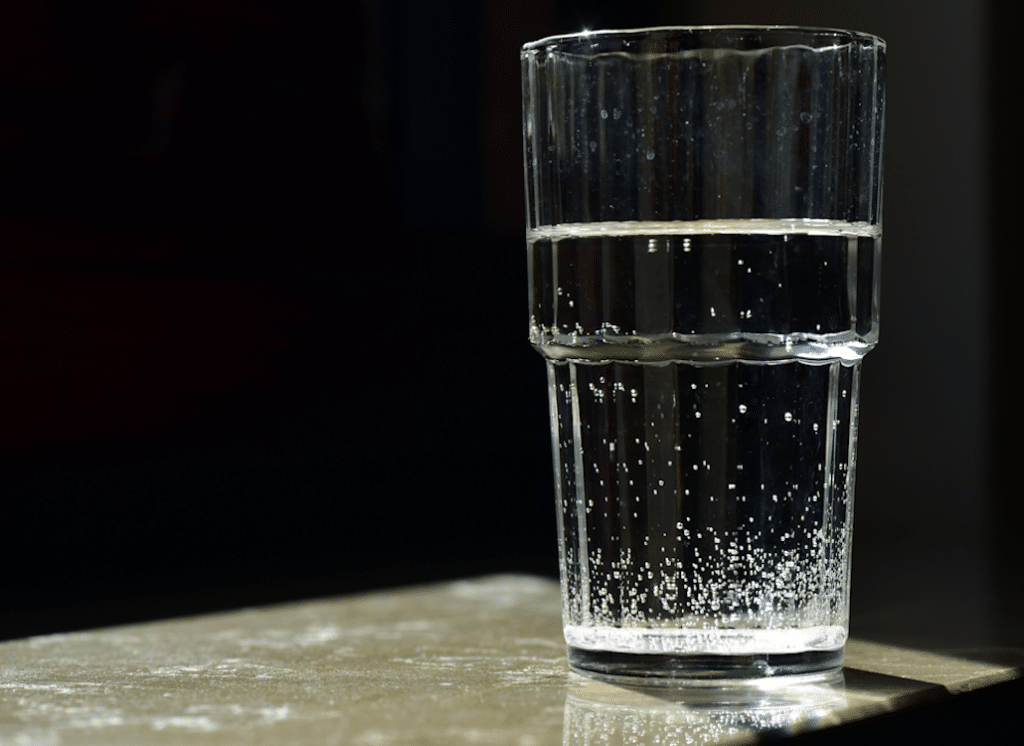
Man entnimmt mit einem durchsichtigen Gefäß dem Teich etwas Wasser und lässt es für einige Zeit stehen. Kalkablagerungen sinken nach einiger Zeit zu Boden und bilden dort einen weißen Belag.
Ebenso sollte man die Gesamthärte, den pH-Wert sowie die Karbonhärte messen. Eine Gesamthärte von über 14 Grad deutscher Härte (°dH) weist auf ein stark kalkhaltiges Wasser hin und ist ein erster Hinweis für einen Kalkausfall. Liegt zudem noch ein pH-Wert von über 8,5 sowie eine Karbonhärte von über 15 °dH vor, so sind Voraussetzung für das Ausfallen des Kalkes erfüllt.
Ursachen
Hat stark kalkhaltiges Wasser (Gesamthärte über 14 Grad °dH) einen hohen pH-Wert (über 8,5) und eine sehr hohe Karbonhärte, entweicht das enthaltene CO². Durch den daraufhin vorliegenden geringen CO² Gehalt können im Wasser nur noch weniger Mineralien gebunden werden, wodurch diese ausfallen und das Wasser milchig weiß verfärben.
Abhilfe
Als Erstes gilt es den Kalkgehalt des Frischwassers zu checken. Liegt hier bereits ein zu hoher Kalkgehalt vor, so sollte das Leitungswasser enthärtet werden, bevor es als Teichwasser verwendet wird!
Achtung: Oftmals wird dazu geraten, das Leitungswasser mit Regenwasser zu vermischen, um so den Kalkgehalt zu senken.
Das Regenwasser verfügt zwar häufig über einen deutlich geringeren Kalkgehalt, wodurch die Gesamthärte im Teich sinkt.
Allerdings ist Regenwasser oftmals auch mit Vogelkot und den daraus folgenden Bakterien sowie mit giftigen Metallen wie Kupfer von der Dachrinne belastet, weshalb wir von dessen Verwendung grundsätzlich abraten!
Liegt die Gesamthärte des Frischwassers unter den 14 Grad °dH, das Teichwasser jedoch über 14 Grad °dH, so steigt der Kalkgehalt im Teich selbst. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
- Es sollte sichergestellt werden, dass keine kalkhaltigen Materialien von außen in den Teich gelangen. Besonders häufig geschieht dies durch Kalksteine oder kalkhaltige Dekogegenstände rund um den Teich herum.
- Ein Verdunsten des Teichwassers kann dazu führen, dass sich die Mineralien im Teich anreichern. Ein regelmäßiger Teilwasserwechsel (jede 1-2 Wochen) bei dem rund ¼ bis ⅓ des Teichwassers getauscht wird ist hilfreich.
- Sind bereits Kalkablagerungen im Teich vorhanden kann man diese mit einer Bürste oder einem Schaber entfernen. Auch der Einsatz eines Hochdruckreinigers verspricht hier Erfolge.
- Mit Essig oder Zitronensäure (Verhältnis 1:5 mit Wasser) kann man Kalkablagerungen an Teichwänden oder Steinen entfernen.
Achtung: Man muss unbedingt darauf achten, dass durch den Einsatz von Zusätzen oder Säuren weder Pflanzen noch Lebewesen beeinträchtigt werden!
4: Unzureichender Sauerstoffgehalt

Eine schlechte Belüftung im Teich kann zu milchigem Wasser führen. Ohne ausreichend Sauerstoff im Wasser zersetzen sich organische Stoffe und Bakterien. Ebenso bietet das sauerstoffarme Wasser Algen oftmals ideale Voraussetzungen, so dass eine Algenplage folgt.
Nicht zuletzt führt der Sauerstoffmangel in den tiefen Teichzonen zur Bildung von Faulschlamm.
Erkennung von unzureichendem Sauerstoffgehalt
Gibt es nicht ausreichend CO² im Teichwasser bekommen die Fische nur schlecht Luft und schwimmen an der Wasseroberfläche. Der pH Wert sinkt und Algen breiten sich rapide aus. Das Teichwasser beginnt unangenehm zu riechen (stinkende Eier).
Am besten lässt sich der Sauerstoffmangel mit einem Wassertest feststellen. Ein beginnender Sauerstoffmangel führt zu einem Anstieg des CO² Wertes. Liegt ein CO² Wert von über 10 ppm (Teile pro Million) vor, so ist dies schon ein deutliches Anzeichen.
Ein fortgeschrittener Sauerstoffmangel führt zusätzlich zu einem Sinken des pH-Wertes. Liegt hier ebenfalls bereits ein pH-Wert von unter 6,0 vor, so sollte die Ursache für den Sauerstoffmangel umgehend behoben werden!
Ursachen
Eine schlechte Sauerstoffsättigung im Teichwasser kann unterschiedliche Auslöser haben: Eine Teichpumpe mit zu geringer Pumpleistung, das Fehlen von Sprudelsteinen, eine zu geringe Wassertiefe, zu hohe Wassertemperaturen oder auch organische Ablagerungen können hierfür verantwortlich sein.
Abhilfe
Um die Belüftung im Teich zu verbessern können folgende Maßnahmen hilfreich sein:
- Eine an die Teichgröße angepasste Wasserpumpe ist neben der Reinigungswirkung für die notwendige Wasserzirkulation notwendig
- Die Ansaugung sowie der Auslauf der Teichpumpe müssen so angebracht sein, sodass das komplette Teichwasser zuverlässig umgewälzt wird.
- Ein Diffusor am Auslauf kann dabei helfen aus dem Filter rückströmendes Teichwasser zu belüften, wodurch sich der Sauerstoffgehalt im Teichwasser direkt erhöht.
- Der Einsatz einer Luftpumpe mit entsprechenden Sprudelsteinen führt ebenfalls zu einem direkten Sauerstoffanstieg.
- Organische Abfälle benötigen Sauerstoff bei der Zersetzung, welche Sie dem Wasser entziehen. Man sollte sie daher unbedingt entfernen!
- Eine unzureichende Wassertiefe führt bei stärkerer Sonneneinstrahlung zu einer starken Erwärmung des Teichwassers, welche sich wiederum negativ auf den Sauerstoffgehalt auswirkt. Damit der Sauerstoffgehalt auch im Sommer ausreichend ist, sollte der Teich eine Mindesttiefe von 1,5 Meter haben. Diese Tiefe hat zudem auch den Nebeneffekt, dass der Teich im Winter nicht durchfriert!
- Pflanzen benötigen Sauerstoff für Ihre Photosynthese. Bei einem geringen Nitratwert von unter 10 mg/l können daher überschüssige, insbesondere schnell wachsende Pflanzen entfernt werden, um so den Sauerstoffbedarf zu senken.
Achtung: Dieser Schritt sollte nur bei einem Nitratwert von 10 mg/l erfolgen, da ansonsten in kürzester Zeit der Nitratwert steigen und Algen entstehen können!
Ebenso sollte man den Nitratwert in den nächsten Wochen genau beobachten. Übersteigt er den Wert von 20 mg/l so sollten die Pflanzen wieder in den Teich gesetzt werden!
5. Algenblüte

Kommt es zu einer Algenblüte im Teich, so hat diese milchiges Teichwasser zur Folge. Allerdings handelt es sich meist eher um eine „grüne Suppe“. Es befinden sich Schwebstoffe oder Algen im Wasser. Diese sind jedoch nur mikroskopisch klein und lassen das Wasser milchig erscheinen.
Es gibt auch eine weiße Algenblüte. Diese tritt auf, wenn sich Blaualgen, Kieselalgen oder Schwämme im Wasser befinden. Diese verdunkeln das Wasser und beeinflussen die Wasserqualität negativ.
Blaualgen, Kieselaglen und Schwämme
Blaualgen als Ursache für milchiges Teichwasser: Blaualgen, auch als Cyanobakterien bekannt, können neben einer grünen oder blauen Färbung auch milchig oder trüb wirken. Enthält das Teichwasser zu viele Nährstoffe (Phosphor und Stickstoff) kann dieses Phänomen auftreten. Die Bakterien vermehren sich schnell.
Kieselalgen: Vermehren sich Kieselalgen (Diatomeen) rasant und massiv, kann das enthaltene Siliziumdioxid sichtbar werden, was eine milchig weiße Farbe verursacht.
Schwämme: Eine weitere Option sind Schwämme oder Cysten, die durch ein vermehrtes Aufkommen das Teichwasser trüben können.
Erkennung
Das Mikroskop gilt als zuverlässiges Erkennungsmerkmal von Kieselalgen.
Blaualgen hingegen bilden blau-grüne Schlieren, einen fauligen Geruch und sammeln sich an der Wasseroberfläche.
Achtung: Bei der Berührung von Blaualgen kann es zu Hautausschlag kommen.
Eine Blaualgenblüte kann man außerdem durch das Vorhalten eines weißen Blattes erkennen. Es reflektiert bereits die grüne Farbe, auch wenn die Algenblüte noch gering ist.
Ursachen für eine weiße Algenblüte
Befinden sich zu viele Nährstoffe im Teichwasser, kann es zu einer weißen Algenblüte kommen. Auslöser sind zu viel Fischfutter, Zersetzungsprozesse von Wasserpflanzen, oder organische Materialien (z.B. Dünger) die durch Regenwasser in den Teich gelangen.
Auch zu warmes Wasser im Teich fördert das Wachstum von Algen. Gerade in den Sommermonaten kommt es daher immer wieder zu einer Algenblüte.
Findet im Teich keine ausreichende Belüftung statt, wird das Algenwachstum begünstigt, da weniger Sauerstoff im Wasser vorhanden ist und die Nährstoffe nicht abtransportiert werden.
Weitere mögliche Ursachen sind ein Überbesatz mit Fischen und zu viel direkte Sonneneinstrahlung während der Sommermonate.
Abhilfe
Es ist wichtig, die nicht optimalen Bedingungen im Teich schnellstmöglich in den Griff zu bekommen. Hierzu zählen:
- Nährstoffe durch das regelmäßige Entfernen organischer Stoffe (Abgestorbene Pflanzen etc.) aus dem Teich und eine reduzierte Fischfütterung reduzieren
- Den Teichbesatz regelmäßig prüfen (kein Überbesatz)
- Eine bessere Filtration durch einen leistungsfähigen Teichfilter hilft, das Teichwasser regelmäßig und kontinuierlich zu reinigen
- Ein UV Klärer zerstört die Algen, indem er die Zellen mit UV-Licht behandelt. Sie können sich anschließend nicht mehr vermehren.
- Der Einsatz von Algenbekämpfungsmitteln gegen Algenblüten sollte mit Bedacht erfolgen. Hier ist auf die Herstellerangaben zu achten und der Einsatzzeitraum so gering wie möglich zu halten, da sonst das ökologische Gleichgewicht im Teich zu leiden beginnt.
Sonderfälle für milchiges Teichwasser
Neu angelegter Teich

Wird ein neuer Teich zum ersten Mal mit Wasser gefüllt, so stellt sich meist in den ersten Tagen eine leichte Bakterientrübung ein. Das Überangebot an Bakterien ruft bald darauf Rädertierchen, Flagellaten, Wimpertierchen, Amöben und andere Einzeller auf den Plan, die sich von diesen Bakterien ernähren.
Und diese mikroskopisch kleinen Filtrierer werden wiederum von Wasserflöhen, Hüpferlinge und anderem mit bloßem Auge sichtbaren Zooplankton gefressen. So entwickelt sich in kurzer Zeit eine ganze Nahrungskette. Das Biologische Gleichgewicht im Teich beginnt sich zu stabilisieren und die anfängliche Bakterientrübung verschwindet wieder – vorausgesetzt der Teich wurde biotopgerecht angelegt und eingerichtet.
Hier muss man also gar nicht eingreifen, lediglich etwas Geduld aufbringen und abwarten können reicht völlig aus.
Alljährliche Algenblüte im Frühling
Das Gleiche gilt auch für die alljährliche Algenblüte zu Beginn der Vegetationsperiode im Frühjahr. Diese Algen bekommen bald darauf mit den höheren Wasserpflanzen, die immer in der Entwicklung etwas hinterherhinken, Konkurrenz um die im Wasser gelösten Nährstoffe. Den Rest besorgt das Zooplankton, welches die im Wasser schwebenden Algen herausfiltriert.